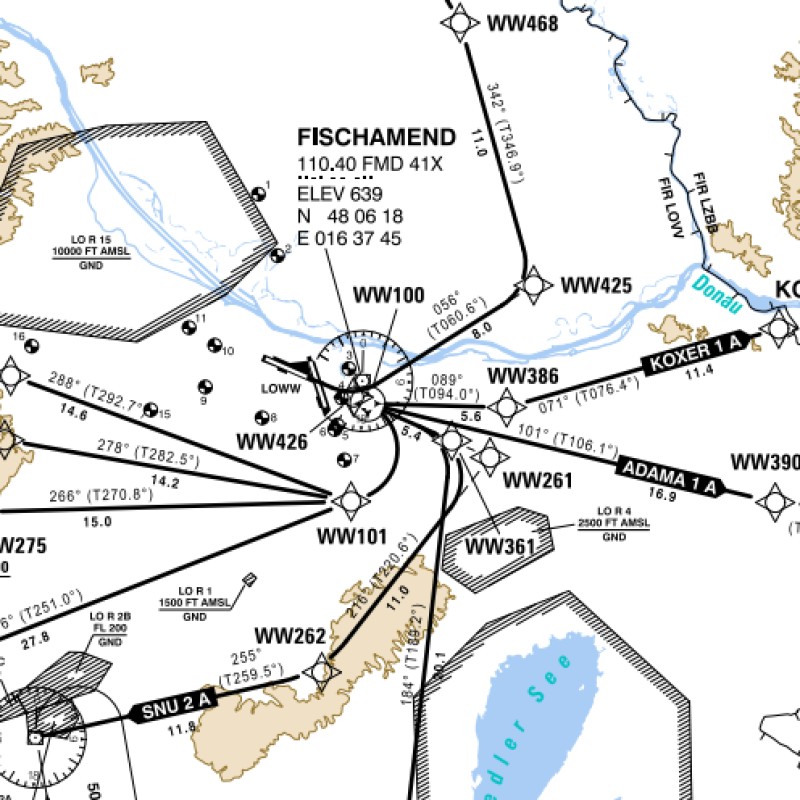Auf Grundlage des für alle hoheitlichen Tätigkeiten geltenden Legalitätsprinzips (Art 18 B-VG) handelt Austro Control dabei ausschließlich im Rahmen dieser Vorgaben und setzt die darin festgelegten Kriterien um. Austro Control vertritt daher weder eigene Interessen noch Interessen spezifischer Gruppen, sondern berücksichtigt all jene – in erster Linie öffentlichen – Interessen, deren Schutz die internationalen und nationalen Vorgaben dienen.
Flugverfahren richten sich an Pilotinnen und Piloten. Sie sind zu beachten, sofern keine abweichende Flugverkehrskontrollfreigabe erteilt wird, also eine vorrangige Einzelanweisung der Fluglotsinnen und Fluglotsen. Flugverfahren entlasten somit den Sprechfunkverkehr und erleichtern die sichere, geordnete und flüssige Abwicklung eines hohen Luftverkehrsaufkommens. Zudem ermöglichen sie bei unvorhergesehenen Ereignissen, wie z.B. dem Verlust des Funkkontakts, einen sicheren Weiterflug auch ohne Anweisung durch die Flugsicherung, weil alle Beteiligten den weiteren Flugverlauf auf Basis des angewendeten Flugverfahrens kennen.